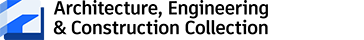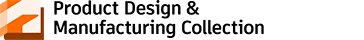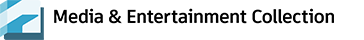Für Exponate in Kunstmuseen gilt normalerweise: „Berühren verboten“. Nicht so bei „Sensing Spaces: Architecture Reimagined“ – die Ausstellung in der Londoner Royal Academy of Arts stand ganz im Zeichen immersiver Installationen von sieben renommierten Architekten, die vornehmlich den Geruchs- und Tastsinn ansprechen sollten.
Besucher durften bunte Plastikstrohhalme in einen Tunnel aus Kunststoff-Wabenkernplatten einflechten, durch einen Saal voller komplexer Bambuskonstruktionen schlendern, die mit den Aromen von japanischem Zedernholz und Tatami getränkt waren, und die Prunkdecke der Galerie über mehrere Wendeltreppen erkunden. Die zehnwöchige Ausstellung endete im April 2014, kann aber in virtueller Form weiterhin besichtigt werden.
Hätten Sie‘s gewusst? Die Idee, primär visuelle Kulturerlebnisse durch olfaktorische Sinnesreize anzureichern, ist keineswegs neu. Bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert gab es immer wieder Versuche zur Realisierung des Geruchs-, Riech- oder Duftkinos – ein Ansinnen, das US-Kultregisseur John Waters in seiner Filmsatire „Polyester“ (1981) gleich mit auf die Schippe nahm: Kinobesucher erhielten Geruchskarten, die sie bei bestimmten Szenen rubbeln mussten, um den jeweils passenden Duft (u. a. „Flatulenz“, „Stinktier“, „schmutzige Schuhe“ und „Lufterfrischer“) freizusetzen. Zur virtuellen Führung