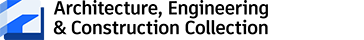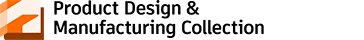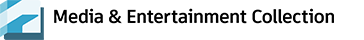Zu den Nebenmotiven bei „Ready Player One“ zählt die Erkenntnis, dass Menschen, die sich in der realen Welt nie als Team zusammengefunden hätten, in der Simulation gemeinsam neue Wege zur Lösung von Problemen gehen. Zusammen können sie mehr, und ein vorurteilsfreier Pluralismus ist dabei selbstverständlich. Ich vertrete zwar nicht die Auffassung, dass die Anonymität der virtuellen Welt eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauung ist. Dennoch leuchtet mir durchaus ein, dass man Menschen, die man nicht sehen kann, ausschließlich aufgrund ihrer Reaktionen und Fähigkeiten anstatt aufgrund von oberflächlichen physischen Merkmalen beurteilt.
Ist Anonymität problematisch, wenn sie ein Treffen zwischen zwei Menschen ermöglicht, die sich ansonsten nie kennengelernt hätten? Natürlich wird sie zum Problem, wenn sie zulässt, dass sich das Internet von seiner schlimmsten Seite zeigt – nämlich in Form von Trollen und Cyber-Mobbing. Was ist aber, wenn eine Person, die sich in der physischen Welt niemals getraut hätte, ihre geniale Idee anderen Menschen mitzuteilen, unter dem Tarnmantel der Anonymität dazu befähigt wird und dadurch etwas in Gang setzt?
In dieser Hinsicht steckt in dem dystopischen Roman „Ready Player One“ viel utopisches Gedankengut: Dort finden Figuren aus vollkommen unterschiedlichen Verhältnissen zusammen, ohne diese Unterschiede je zu thematisieren. Sie lösen gemeinsam Probleme und müssen im Nachhinein ihre physischen und virtuellen Identitäten miteinander vereinbaren, bis ihnen schließlich klar wird, dass sie bessere Menschen sind, als sie je gedacht hätten.
Eine Umgebung wie die OASIS verstehe ich als Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, miteinander zu kombinieren oder misslingen zu lassen, Entscheidungen zu treffen und im Handumdrehen eine Gruppe von Menschen aus aller Welt und mit unterschiedlichen Anschauungen und Erfahrungen zusammenzubringen, um gemeinsam Aufgaben zu bewältigen. Persönlich würde ich nicht so arbeiten wollen – aber um meine Vorlieben und Abneigungen geht es hier nicht. Für die Generation der digital Geborenen ist es ganz normal, Tausende Freunde zu haben, die sie nur aus dem Internet kennen. Ihnen wird es ebenso selbstverständlich vorkommen, virtuell und standortfern mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten – zumal die einschlägigen Tools immer „lebensechtere“ Szenarien ermöglichen.
In Zukunft werden Planer und Ingenieure womöglich gemeinsame Projekte erfolgreich abwickeln, ohne sich je persönlich gegenüberzusitzen. Stattdessen können sie in einer XR-Umgebung (die Abkürzung steht für Extended Reality bzw. Erweiterte Realität und ist ein Sammelbegriff für verschiedene Mensch-Maschine-Interaktionen und Kombinationen aus realen und virtuellen Elementen) kommunizieren, planen, gestalten, analysieren und entscheiden.