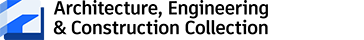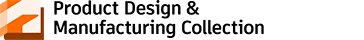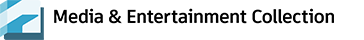Einer, dem die Ressourcenknappheit schon in den 1990er-Jahren klar war, ist Werner Sobek. Der in Aalen geborene Bauingenieur, Architekt und Mitinitiator der DGNB blickt heute auf ein Imperium aus Büros zwischen New York, Dubai und Buenos Aires. Das Portfolio reicht von der Fassadenplanung und Nachhaltigkeitsberatung des ADNOC Tower in Abu Dhabi bis zur Entwicklung eines Energiekonzepts für die Waldkliniken in Eisenberg, Thüringen. Sobek fordert, mit weniger Material für mehr Menschen zu bauen.
Am besten lässt sich das erklären, wenn man sich Sobeks Privathaus in Stuttgart ansieht. Sobek, der das schwäbische Näseln bei aller Weltgewandtheit nie ganz verloren hat, nennt sein Privathaus R128, was erst mal wie ein Star Wars-Roboter klingt und glauben lässt, es müsse das wundersamste Smart Home am Rande des Stuttgarter Kessels sein mit allerlei intelligent vernetzter Schmankerl.
Tatsächlich ist es nur die etwas hippere Abkürzung für „Römerstraße 128“. Das Haus liegt in bescheidener Größe an einem Hang, umgeben von Natur, komplett verglast, mit einem so minimalistischen Interieur, dass man denken könnte, hier lebe niemand. Sobeks Haus ist ein Manifest seiner eigenen Gedanken, eines, das möglichst wenig Energie verbraucht und aus rezyklierbarem, also wiederverwertbarem Material besteht. Das können Kupferplatten, Glas oder Stahlgerüste sein, die zuvor an anderen Gebäuden angebracht waren. „Mein Jugendtraum war, auf einer grünen Wiese in einer Seifenblase zu leben. Heute ist es eine kubische Seifenblase“, sagt Sobek in einem Video des Youtube-Kanals seiner Unternehmensgruppe.